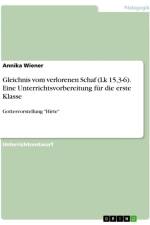von Annika Wiener
17,95 €
Unterrichtsentwurf aus dem Jahr 2017 im Fachbereich Pädagogik - Unterrichtsvorbereitung allgemein, , Sprache: Deutsch, Abstract: Gleichnisse sind meist kürzere Texte mit narrativem Charakter, die zwei Ebenen aufweisen. Einerseits die Bildebene, also die konkrete erzählende Geschichte und daneben die Sachebene, die danach fragt, was uns das Gleichnis sagen soll. Die Ebenen beziehen sich aufeinander und im sogenannten Vergleichspunkt tangieren sie. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf ist ein Gleichnis im engeren Sinn, hierbei wird die Sachebene parallel zur Bildebene genannt. Es wird etwas bildlich dargestellt, ohne dass es explizit genannt wird. Das Nutzen bekannter Bilder und die Einbettung in die damalige Lebenswelt hilft den Menschen beim Verständnis. Zentral steht aber nicht das Schaf an sich, sondern die Rolle des Hirten und das Suchen und Wiederfinden verbunden mit großer Freude. Ein Schaf ist ein einfältiges Tier, welches vom Hirten geschützt werden muss. Es folgt blindlings einer Menge und gerät schnell in Panik. Somit hat der Hirte die wichtige Aufgabe alle Schafe seiner Herde beisammen zu halten und auf sie Acht zu geben, damit kein wildes Tier eines der Schafe holt. Ein Hirte kennt seine Schafe und kümmert sich um jedes einzelne. In Bezug auf die Entwicklung des Glaubens der Kinder wird das Modell von FOWLER betrachtet. Erstklässler sind hier der Stufe des mythisch-wörtlichen Glaubens zuzuordnen. Entsprechend ihres konkret-operationalen Denkens, wird Gehörtes und Gelesenes wörtlich genommen. Erzählungen werden nicht als symbolische Sprache erkannt, sondern dem Wortsinn nach verstanden. Aufgrund dieses wörtlichen Verstehens wird Gott ganz wie ein menschliches Wesen aufgefasst. So wurde er von allen Kindern in einer der Vorstunden auch gemalt. Auf die Unterrichtsstunde bezogen bedeutet dies, dass die Schüler das Gleichnis sehr kindgerecht erzählt bekommen müssen und Hilfe benötigen, um den eigentlichen Sachgehalt zu verstehen und Gott nur bildlich auch als Hirten erkennen. Metaphern sind für sie nur sehr schwer verständlich. Es ist wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler das Gleichnis nicht wörtlich nehmen und meinen, dass ihnen nie etwas passieren kann, wenn sie zum Beispiel weglaufen, weil Gott immer bei ihnen ist. Es gilt, dass den Kindern primär die besondere Fürsorge Gottes, auch bei teils unbeabsichtigt gemachten Fehlern, klar wird.