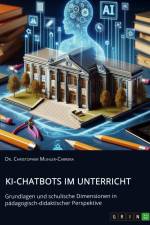von Christopher Muhler-Carrera
18,95 €
Essay aus dem Jahr 2024 im Fachbereich Pädagogik - Medienpädagogik, , Sprache: Deutsch, Abstract: Der Text will den Versuch unternehmen, pädagogisch-didaktische Perspektiven aufzuzeigen und einzuordnen. Dabei sollen die folgenden Ausführungen nicht als Werbung für KI-Chatbots oder Stigmatisierung traditionellen Unterricht verstanden werden. Ziel ist eine erfahrungsbasierte, kritische Beleuchtung entsprechender Dimensionen und die Darstellung von Chancen und Grenzen. Dies gilt exemplarisch für den gesellschaftswissenschaftlichen Bereich schulischer Bildung, da im sprachlichen und naturwissenschaftlichen Bereich andere Anwendungsdimensionen im Mittelpunkt stehen, obgleich es natürlich auch Überschneidungen gibt.Seit dem Ende des Jahres 2022 sind KI-Chatbots, allen voran ChatGPT des Unternehmens Open AI, im schulischen Bereich in den Fokus didaktischer und pädagogischer Überlegungen gerückt.Während die einen darin eine Möglichkeit für innovatives Lernen, Fortschritt und Technologieoffenheit und damit neue Zeichen einer Zäsur erkennen wollten, sahen andere eher Gefahren, Grenzen und Probleme auf die Schulen zukommen. Recht haben aber weder die einen, noch die anderen. Die Wahrheit, sofern man diesen Terminus nutzen möchte, liegt wie bei vielen Dingen aber in der Mitte. Es kommt darauf, wie KI-Chatbots wie ChatGPT, Copilot oder Bard konkret genutzt werden, welche Inhalte und Ziele definiert werden und mit welcher didaktischen Begründung diese Technologie im Unterricht eingesetzt wird.Als Prämisse muss feststehen, dass KI-Chatbots ¿ und das gilt für alle KI ¿ nie als Selbstzweck dienen dürfen, sondern immer in pädagogische und didaktische sowie zunehmend soziale Dimensionen im Rahmen schulischer Bildung und Erziehung eingebettet werden. Sonst besteht die Gefahr einer willkürlichen Nutzung ohne Sinn und Verstand, einer unkritischen Übernahme generierter Inhalte, was der Ausbildung mündiger Schüler abträglich wäre. Setzt man aber einen kritischen Umgang mit KI-Chatbots voraus und versucht, die Chancen zu gestalten, können diese eine große Bereicherung für Lehrkräfte und Schüler sein.