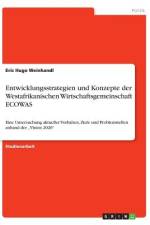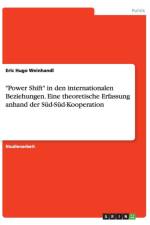von Eric Hugo Weinhandl
17,95 €
Studienarbeit aus dem Jahr 2018 im Fachbereich Politik - Politische Theorie und Ideengeschichte, Note: 1, Universität Wien (Institut für Internationale Entwicklung), Veranstaltung: Ringvorlesung Kritik | Widerspruch | Widerstand, Sprache: Deutsch, Abstract: Der Staat wird von einem Großteil unserer (westlichen) Gesellschaften als alleinige und kollektiv legitimierte Autorität anerkannt. Eine Autorität, die soziale, politische wie ökonomische Realitäten verwaltet, organisiert, letztlich beherrscht. Besonders das Recht auf Gewaltanwendung zum Zwecke der Durchsetzung von Zwang wird ihm alleine und seinen ihn konstituierenden Institutionen sowie deren "Gewalten" zugebilligt. Nicht umsonst spricht man auch von der "Staatsgewalt". Dabei beruft sich der Staat, als künstliche Entität, auf das Konzept des Kontraktualismus, genauer gesagt den Gesellschaftsvertrag, um Gewalt und Zwang zu legitimieren. Vereinfacht formuliert, besagt dieser, dass das Individuum den (scheinbar) archaischen Naturzustand verlässt und einen Großteil seiner Freiheiten im Gegenzug für kollektiv organisierte Sicherheit ¿ etwa in Form des Staates ¿ eintauscht. Dass diese Annahme, welcher der Vertrag zugrunde liegt, bei genauerer Analyse diverse Fehler aufweist, etwa die Dichotomie zwischen Autorität und Freiheit, prangern Anarchisten, Anti-Etatisten, Radikal-Liberale und nicht zuletzt Libertäre seit jeher an. Sowohl auf theoretischer Ebene in der Wissenschaft, als auch auf praktischer anhand sozialer wie politischer Mobilisierung. Das scheinbar alternativlose Konzept des Staates wird durch verschiedenste Formen der Widerständigkeit hinterfragt und gleichzeitig in Praxis und utopistischen Ideen alternativ weiterentwickelt.In diesem Essay wird daher versucht, sich den politischen Konzepten von Staatlichkeit und Widerstand sowie damit einhergehenden philosophischen Reflexionen aus libertärer Perspektive anzunähern. Dem Leser soll anhand eines konkreten Beispiels prägnant vermittelt werden, wie Libertarismus Staatskritik und Widerstand im Spannungsverhältnis zwischen Individuum und Staat erfasst, denkt und letztlich auch umsetzt und dabei eine große Bandbreite an politischen ebenso wie soziologischen und ökonomischen Überlegungen in seine Philosophie integriert. Die politische Philosophie des Libertarismus, als marktwirtschaftlich basierte Weiterentwicklung des individuellen Anarchismus, wird indiesem Falle herangezogen, weil sie sich sowohl in ihrer Kritik als auch in ihren Handlungsanleitungen dem Widerstand und in radikaler Weise auch der Überwindung jeglicher Staatlichkeit verschreibt, dabei aber auf Gewalt verzichtet.