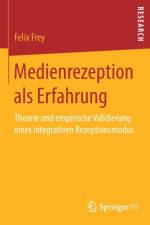von Felix Frey
17,95 €
Studienarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich Geschichte Deutschlands - Erster Weltkrieg, Weimarer Republik, Note: keine, Universität Leipzig (Institut f. Kulturwissenschaften), Veranstaltung: Kulturgeschichte der Weimarer Republik, Sprache: Deutsch, Abstract: Glas, Stahl, Beton, das Ganze kubisch mit Flachdach arrangiert und weiß getüncht. Das ist das Bild, das der durchschnittlich Architekturbewanderte mit dem Funktionalismus des sog. Neuen Bauens der 1920/30er Jahre verbindet. Dass dieses Bild der avantgardistischen Architektur sehr verkürzt und zum Teil falsch ist, ist die eine Sache; dass es nur eine der vielen möglichen Perspektiven auf die Architektur der 20er Jahre ist, ist die andere. Denn die ästhetische Betrachtungsweise der Architektur des Neuen Bauens vermag es z.B. nur schwerlich, auch die phantastisch-utopischen Formen der frühen Bauten der Architekten des Neuen Bauens zu ¿erklären¿. Eine kulturgeschichtliche Perspektive auf das Neue Bauen möchte demgegenüber hinter die Beton-Kulissen schauen und die kulturellen ¿Fundamente¿ freilegen, auf denen diese Architektur errichtet wurde. Gerade die teilweise harschen v.a. publizistisch geführten Auseinandersetzungen zwischen ¿Traditionalisten¿ und ¿Modernen¿ verweisen nämlich darauf, dass Kunst incl. Architektur stets in Interaktion mit Gesellschaft, Kultur und damit auch Wertvorstellungen entsteht: Die Debatten um das Neue Bauen wurden weniger darüber geführt, ob Flachdächer hübscher als Walmdächer sind, sondern darüber, ob Flachdächer weniger deutsch als Walmdächer sind, ob sie nicht stattdessen bolschewistische Dächer und damit schädlich für Volksgesundheit, Volksgeist usw. sind. Die Argumentationen waren somit v.a. ideologische, nicht ästhetische.Die ¿Idee¿, als deren gebauter Ausdruck sowohl die ganz zu Beginn repetierten Klischees als auch die erwähnte utopisch-phantastische Architektur direkt nach dem ersten Weltkrieg verstanden werden kann, ist der sog. soziale Gedanke des Neuen Bauens. Er ist die Konstante, die dem Wirken der Architekten des Neuen Bauens innewohnt.Ziel der Arbeit soll also sein, zunächst die Entstehung des sozialen Gedankens aus den spezifischen Bedingungen der Kriegs- und Nachkriegszeit zu erläutern, danach zu versuchen, den erwähnten stilistischen Umschwung der Architekten des Neuen Bauens hin zum rationalen Funktionalismus als Neuinterpretation des sozialen Gedankens unter dem Einfluss des sozialen Wohnungsbaus und dem allgemeinen Rationalisierungsenthusiasmus zu beschreiben und abschließend die Konsequenzen darzustellen, welche die Architekten des Neuen Bauens im Zuge dieser Neuinterpretation für ihr gestalterisches Schaffen zogen.