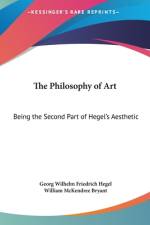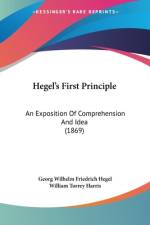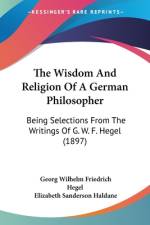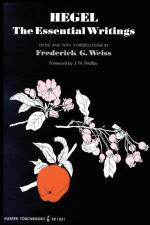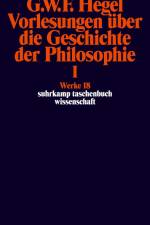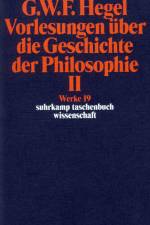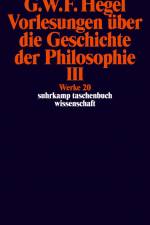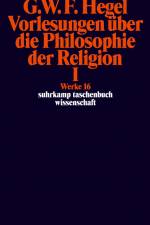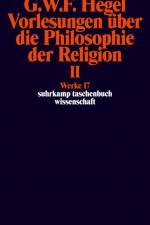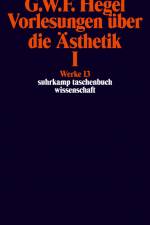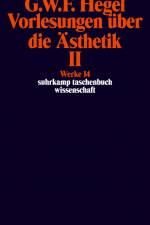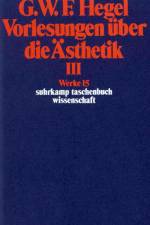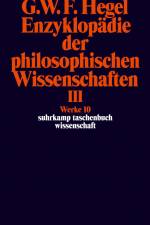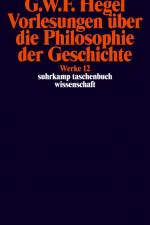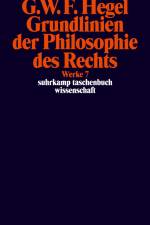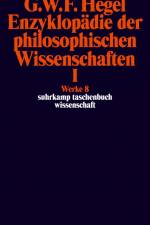von Georg Wilhelm Friedrich Hegel
65,00 €
""Philosophie De La Religion De Hegel V2 (1878)"" is a French language book written by the German philosopher Georg Wilhelm Friedrich Hegel. The book is the second volume of Hegel's philosophy of religion, and was originally published in 1878. The book explores Hegel's ideas on religion and its role in society, as well as his views on the relationship between religion and philosophy. It covers a range of topics, including the nature of God, the role of religion in history, and the relationship between faith and reason. Throughout the book, Hegel draws on a wide range of philosophical and theological sources, including the works of Immanuel Kant, Friedrich Schelling, and Martin Luther. He also engages with contemporary debates about religion and its place in modern society. Overall, ""Philosophie De La Religion De Hegel V2 (1878)"" is a complex and challenging work of philosophy that will appeal to scholars and students of religion, philosophy, and theology. It provides a detailed and nuanced exploration of Hegel's ideas on religion, and is an important contribution to the ongoing conversation about the role of religion in modern society.This scarce antiquarian book is a facsimile reprint of the old original and may contain some imperfections such as library marks and notations. Because we believe this work is culturally important, we have made it available as part of our commitment for protecting, preserving, and promoting the world's literature in affordable, high quality, modern editions, that are true to their original work.