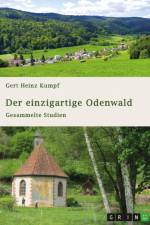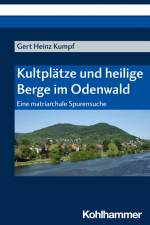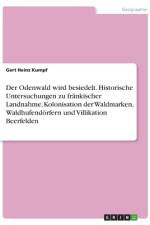von Gert Heinz Kumpf
57,95 €
Forschungsarbeit aus dem Jahr 2023 im Fachbereich Kulturwissenschaften - Sonstiges, , Sprache: Deutsch, Abstract: Der Odenwald ist in der Schönheit seiner Wälder, Höhen, Täler und Hänge ein einzigartiges Gebirge. Jedes Tal hat seinen eigenen, unverwechselbaren Charakter. Über viele Kilometer kann man durch einsame, ursprüngliche Buchen-Eichen-Mischwälder streifen, mit dem sauberen roten Sand unter seinen Füßen, und an glasklaren Quellen trinken.Der Autor legt hier die gesammelten Studien seines Heimatgebirges vor. In insgesamt neun Schriften hat er sich unter verschiedenen Aspekten mit diesem Gebirgsjuwel beschäftigt. Acht dieser Schriften werden hier vorgelegt. Die Studien beginnen mit der Geographie, werden mit der Geschichte fortgesetzt und schwenken dann zur Sagenwelt, um schließlich die immer noch unerklärlichen Namen des Odenwaldes und seiner einzigen Großstadt Heidelberg kulturgeschichtlich zu durchleuchten.Die folgenden acht Bücher sind hier zusammengefasst: ¿Der Odenwald ungeteilt und einzigartig. Geographische Analysen zu Abgrenzung, Entstehung, Großlandschaften, Limes, Talsystemen und Gewässernamen des Gebirges¿ von 2021, ¿Historische Studien im Odenwald. 18 Untersuchungen von der Jungsteinzeit über fränkische Landnahme, Kolonisation der Klöster, Zenten, Bauernkrieg und Reichskreis bis zur Grafschaft Erbach¿ von 2022, diese Studien wiederum sind eine überarbeitete Fassung der Texte ¿Der Odenwald wird besiedelt¿ von 2021 und ¿Der Odenwald mit Zenten und Grafen¿ von 2021; es folgen ¿Sagenkreise und Nibelungenorte im Odenwald. Eine mythologische Spurensuche¿ von 2022 und ¿Die Nibelungensage im Home-Office. Thesen zur Sage und Protokoll einer Unterrichtseinheit zu Zeiten der Pandemie (Gymnasium Deutsch, Klasse 7) von 2020; und schließlich noch ¿Zum Namen der Stadt Heidelberg. Forschungen unter Einbezug von Geographie und Kulturgeschichte¿ von 2023 und ¿Der Name des Odenwaldes. Von Odin zur Wassermutter¿ von 2023.Nicht in dieses Kompendium aufgenommen, dem Leser aber trotzdem wärmstens empfohlen, ist die kulturwissenschaftliche Forschungsarbeit ¿Kultplätze und heilige Berge im Odenwald. Eine matriarchale Spurensuche¿, die 2023 im Kohlhammer Verlag Stuttgart erschienen ist.