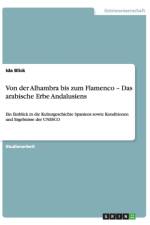- Paroemiologie in der interkulturellen Fremdsprachendidaktik
von Ida Blick
17,95 €
Studienarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich Didaktik für das Fach Deutsch - Deutsch als Fremdsprache, DaF, Note: 1,0, Universität Bayreuth (Interkulturelle Germanistik), Veranstaltung: Interkulturelle Fremdsprachendidaktik, Sprache: Deutsch, Abstract: Sprichwörter lassen sich sowohl aus semantischer, lexikalischer aber auch aus historischer und kulturwissenschaftlicher Perspektive untersuchen. In dieser Arbeit wurde jedoch kein Korpus an Sprichwörtern oder ihre Verwendung im Deutschen analysiert, sondern ihre Funktionen, ihre didaktischen Möglickeiten und speziell ihre Relevanz im Fach ¿Deutsch als Fremdsprache¿. Gegenwärtig zeigt sich, dass entgegen der weitverbreiteten Meinung sowie kultur- und sprachpessimistischen Prognosen, Sprichwörter keineswegs ein vom Aussterben bedrohtes Phänomen sind. Studien und Analysen belegen, dass den Sprechern des Deutschen immer noch eine bedeutende Zahl von Sprichwörtern geläufig sind. Besonders wichtig in diesem Zusammenhang ist jedoch ihr Strukturwandel, d.h. die Variation im direkten Sprachgebrauch: Häufig werden Sprichwörter nicht mehr in ihrer ursprünglichen Form verwendet, sondern als Antisprichwörter oder sogenannte Wellerismen erweitert und erhalten so ein ¿neumoralisches Kleid¿. Dieser Aktualitätsbezug von Sprichwörtern, der sich nicht selten in den Medien oder auch der Jugendsprache niederschlägt, lässt sich durchaus auch im Deutsch als Fremdsprache-Unterricht einsetzen. Zu betonen ist jedoch, dass als Grundlage zum Verständnis dieser Sprichwortvariationen die ¿Originale¿ bekannt sein müssen. Deswegen wurden in dieser Arbeit zunächst untersucht, welcher linguistischen Kategorie Sprichwörter zuzuordnen sind. Danachwurden ihre Funktionen bestimmt, wobei in diesem Kontext vor allem auf ihre kulturellen Attribute eingegangen wurde. Erst nach diesen Punkten war es möglich und sinnvoll zu klären, welche Relevanz Sprichwörter im DaF-Unterricht haben und wie sie dort eingesetzt werden können ¿ besonders im Sinn einer interkulturellen Fremdsprachendidaktik. In diesem Zusammenhang wurde anhand von Beispielen aufgezeigt, wie Sprichwörter in Lehrwerke integriert werden. Zudem wurden Strategien der Bedeutungsvermittlung wie die kontrastive Phraseologie und der phraseodidaktische Dreischritt vorgestellt. Ein kritisches Resümee und ein Ausblick runden die Arbeit ab. Letztlich wurden im Rahmen dieser Arbeit folgende Fragen beantwortet: Sind Sprichwörter grundsätzlich im DaF-Unterricht sinnvoll? Können Sprichwörter ¿Kultur¿ vermitteln? Gibt es Methoden der Phraseo- bzw. Parömiodidaktik, die dem Ziel einer interkulturellen Didaktik entsprechen?