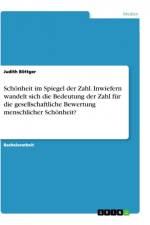von Judith Böttger
17,95 €
Studienarbeit aus dem Jahr 2018 im Fachbereich Medien / Kommunikation - Multimedia, Internet, neue Technologien, Note: 1,0, Universität Potsdam, Sprache: Deutsch, Abstract: In der vorliegenden Hausarbeit wird sich mit dem algorithmischen Sehen, genauer mit Schönheit im Auge des Algorithmus, befasst. Konkret wird es um EyeEm Vision gehen. Dabei handelt es sich um die automatische Bilderkennungstechnologie des Berliner Startups EyeEm, die mithilfe von Computer Vision ästhetische Werturteile fällt und in den im Zitat erwähnten Feldern farbiger Pixel auch Gesichter, Personen, Räume und Gegenstände erkennt.Doch nach welchen Regeln und Vorkenntnissen entscheidet der Algorithmus, wie schön ein Bild ist? Woher nimmt er seine Definition von Schönheit?Diese Fragen werden im Verlauf der Arbeit beantwortet. Ziel ist es, EyeEms ästhetischer Wertungspraxis auf den Grund zu gehen und diese dann kritisch zu hinterfragen.Den Begriff der Schönheit zu fassen, stellt für die Menschen seit mehreren Jahrhunderten eine Herausforderung dar. Es scheint so, als könne man ihr Wesen nicht verallgemeinern, als sei für jeden etwas anderes schön. Individuelle Meinungen treffen aufeinander und folglich hat man sich darauf geeinigt, dass Schönheit wohl im Auge des Betrachters liegen müsse. Aber was geschieht, wenn der Betrachter gar keine Augen hat, und dennoch sieht? Wenn ein Algorithmus entscheidet, was schön ist und was nicht, wird die Diskussion womöglich noch um einiges komplizierter.Die Digitalisierung verwandelt Bilder virtuell in Ziffern und damit das Sichtbare zu symbolischen Daten, die beliebigen Rechenoperationen ausgesetzt werden können. Seitdem sind Bilder einem Blick ausgesetzt, der sie nicht mehr nur durch menschliche Sinne, sondern auch im algorithmischen Sinn testet. Sie werden aufgelöst, zerstückelt, wieder zusammengesetzt, analysiert, zergliedert und mathematisch generiert.Diese Worte finden sich bereits 2003 im Editorial von ¿Suchbilder¿ von Wolfgang Ernst, Stefan Heidenreich und Ute Holl. Im digitalen Zeitalter sind das Sehen und weiterführend auch das Erkennen nicht nur menschliche Fähigkeiten. Auch Computer werden zunehmend mit Programmen ausgestattet, die auf ihre eigene Weise mit Bildmaterial umgehen.Aber zwischen den endlosen Ziffernkolonnen und den Gestalten, die ein menschlicher Blick erkennt, gähnt eine Lücke. [...] Auf der einen Seite stehen die Rohdaten, die Bilder als Felder farbiger Pixel kodieren; auf der anderen Seite eine Wahrnehmung, die nicht anders kann, als etwas zu sehen: Gesichter, Personen, Räume, Gegenstände.2