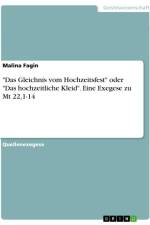von Malina Fagin
17,95 €
Quellenexegese aus dem Jahr 2016 im Fachbereich Theologie - Biblische Theologie, Note: 2,0, Leuphana Universität Lüneburg, Veranstaltung: Literaturwerke der Bibel und ihre Exegese, Sprache: Deutsch, Abstract: Die folgende Exegese bezieht sich auf die Textstelle ¿Das Gleichnis vom Hochzeitsfest¿ oder auch ¿Das hochzeitliche Kleid¿ aus Matthäus 22,1-14. Sie wird im Rahmen des universitären Seminars ¿Literaturwerke der Bibel und ihre Exegese¿ verfasst, dabei soll die Textstelle anhand einiger historisch-kritischer Methoden untersucht werden. Mir persönlich ist dieser Bibelabschnitt vor einiger Zeit beim Bibellesen aufgefallen, als ich mich mit den Himmel- und Höllenbildern, die die Bibel zeichnet, befassen wollte. Ich habe allerdings daraufhin nie eine Predigt oder eine andere Vertiefung über genau dieses Gleichnis gehört, sodass mir demgegenüber viele Fragen offengeblieben sind, die ich im Laufe dieser exegetischen Arbeit bearbeiten möchte. Im Vordergrund steht für mich die Frage, über wen genau Jesus in diesem Gleichnis spricht und was den Kern der dahinterstehenden Botschaft darstellt, die Jesus auch zusammenfassend im letzten Vers formuliert.Die Bibel stellt für mich eine Ansammlung an authentischen Schriften dar, die von Erlebnissen berichten, die Menschen mit Gott erlebt haben. Es ist dabei wichtig, die Schriften in ihrem historischen Kontext zu betrachten und gleichzeitig die aktuelle Relevanz herauszustellen. Ich denke nicht, dass die Bibel mit der Zeit an Wahrhaftigkeit oder Gültigkeit verloren hat, vielmehr vertraue ich darauf, dass Gott besonders durch die Bibel, als lebendiges Buch, in allen Zeiten an den Menschen wirken will. Es können Erklärungsversuche geliefert werden, aber alleine die unterschiedlichen Interpretationen in unterschiedlichen Epochen sind kennzeichnend dafür, wie vielschichtig die biblischen Texte sind und wie sehr ihre Interpretation von dem Interpreten abhängig ist. Diese Art des Bibelverständnisses lege ich der folgenden Ausarbeitung zugrunde.