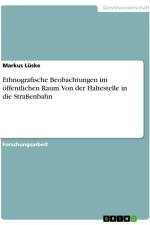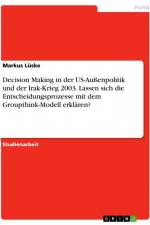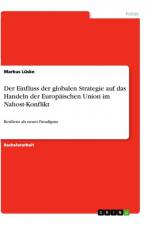von Markus Lüske
15,95 €
Forschungsarbeit aus dem Jahr 2019 im Fachbereich Soziologie - Individuum, Gruppe, Gesellschaft, Note: 1,3, Bayerische Julius-Maximilians-Universität Würzburg (Institut für Politikwissenschaft und Soziologie), Veranstaltung: Qualitative Methoden, Sprache: Deutsch, Abstract: In meiner empirischen Studie habe ich alltägliche Interaktionssituationen im öffentlichen Raum anhand von teilnehmenden Beobachtungen der sozialen Praktiken der Akteure*innen an Haltestellen und in der Straßenbahn untersucht. Dabei stellte ich fest, dass sich hinter dem ungeordnet und individuell erscheinenden Verhalten der Wartenden und Straßenbahnfahrer*innen - von dem Moment des Wartens über den Einstieg bis hin zur Platzwahl und dem Verlassen der Bahn - sehr wohl strukturierte Muster finden lassen, von denen man auf soziale Regeln schließen kann.Ich nehme zuerst eine theoretische Einordnung meiner Beobachtungen vor, erläutere anschließend das methodische Vorgehen und stelle dann meine Beobachtungsergebnisse dar, indem ich zuerst die Phasen des Wartens, des Ein- und Ausstiegs beleuchte, dann zur Sitzplatzwahl und zum Verhalten während der Fahrt übergehe und abschließend die aus der Analyse gewonnenen Befunde in einem Fazit zusammenfasse.Die Erforschung des sozialen Handelns von Individuen im öffentlichen Raum ist zu einem soziologischen Untersuchungsfeld geworden, seitdem das Alltägliche in der Mikrosoziologie mehr Beachtung findet. Forscher*innen betrachten Alltagssituationen als soziologische Phänomene, weil die beobachtbaren sozialen Praktiken verdeutlichen, wie sich soziale Ordnung in ihrer kleinsten Form erzeugt.Mein Erkenntnisinteresse fußt auf eigenen alltäglichen Erfahrungen: Man befindet sich auf engem Raum mit fremden Menschen, reflektiert die Situation jedoch meist nicht weiter. Verhaltensroutinen, die wir Tag für Tag in verschiedenen Situationen ausüben, erschweren den Blick für die dahinterliegenden Strukturen und Regeln. Oft wird uns erst durch eine außergewöhnliche Begebenheit oder durch die bewusste Entfremdung der alltäglichen Lebenswelt klar, wie sehr unser Verhalten in einer sozialen Situation von Verpflichtungen, Erwartungen und Regeln determiniert wird.