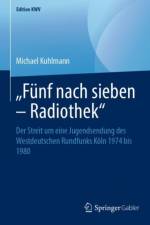von Michael Kuhlmann
17,95 €
Studienarbeit aus dem Jahr 1997 im Fachbereich Geschichte Deutschlands - Nachkriegszeit, Kalter Krieg, Note: 1,0, Universität Münster (Historisches Seminar), Veranstaltung: Hauptseminar "Die ¿Deutsche Frage¿ als ein Thema der Geschichtslehrbücher der BRD und der DDR 1949-1989", Sprache: Deutsch, Abstract: "Damals habe ich die große Hoffnung gehabt, [...] die militante Kampfbereitschaft der Kommunisten würde sich mit den demokratischen Traditionen und demokratischen Umgangsformen der Sozialdemokraten zu einer neuen, besseren Linkspartei zusammenfassen. Damals, da ich viele Dinge nicht kannte, war ich optimistisch und habe mich damals dafür eingesetzt, aber schon sehr bald erkannt, daß meine Hoffnungen eine Illusion waren."Gemeinsam mit einigen Hundert sozialdemokratischer und kommunistischer Delegierter hatte sich der junge Kommunist Wolfgang Leonhard am 21. April 1946 im Berliner Admiralspalast eingefunden, um einen entscheidenden Schritt ostdeutscher Nachkriegsgeschichte zu vollziehen: die Vereinigung von KPD und SPD zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Drei Jahrzehnte nach Ausbruch des Zwistes in der Sozialdemokratischen Partei schien die verhängnisvolle Spaltung endlich überwunden - wenn auch nur in einem Teil Deutschlands. Begleitet von großen Hoffnungen, aber auch von tiefer Besorgnis begann die SED ihre politische Arbeit, deren Resultate nicht nur den Idealisten Leonhard sehr bald enttäuschen sollten."Wat, schon wieder 'ne Partei? Ick hab noch von der vorigen die Neese voll!" Wer wie dieser Berliner in der Nachkriegswelt des Frühsommers 1945 Tag für Tag ums Überleben kämpfen mußte, zeigte für Parteigründungen wie diejenige der KPD kaum Interesse. Das politische Leben, das sich trotz Not und Kriegszerstörungen, trotz aller Überlebenssorgen bereits im Deutschland der ersten Nachkriegsmonate wieder entfaltete, beschränkte sich auf kleinere Kreise, war gleichwohl von hoher Intensität.Die Arbeit befaßt sich mit der Politik von SPD und KPD in der Sowjetischen Besatzungszone, die elf Monate nach Kriegsende zur Verschmelzung beider Parteien führte. Wiewohl kaum umfassend zu beantworten, drängen sich doch immer wieder die Fragen auf, ob die KPD 1945/46 wirklich eine parlamentarische Demokratie anstrebte und ob der Akt von Ostern 1946 seitens der SPD ein freiwilliger Schritt war.