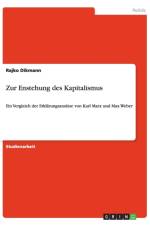von Rajko Dikmann
16,95 €
Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Politik - Internationale Politik - Region: Russland, Länder der ehemal. Sowjetunion, Note: 2,3, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Veranstaltung: Seminar: Analyse und Vergleich politischer Systeme, Sprache: Deutsch, Abstract: In Russland gibt es immer zwei Wahrheiten, ¿eine Realität der offiziellen Erklärungen und Normen, und eine andere, wirkliche Realität der faktischen Ereignisse, die nur verborgen, im Schatten existiert und so gut wie nichts mit den offiziellen Verlautbarungen zu tun hat¿ (vgl. Hassel 2003: 2). Diese Kritik der russischen Politik brachte Florian Hassel in seinem Buch ¿Der Krieg im Schatten: Russland und Tschetschenien¿ an, um jenes Dilemma Russlands zu beschreiben, in dem die russische Verfassung als Garant für Demokratie und Freiheit steht, gleichwohl die Realpolitik des Landes unverkennbar von besagter Verfassung abweicht.Diese Arbeit hat sich das Ziel gesetzt, auf die Frage, ob Russland nach der Systemtransformation eine defekte Demokratie sei, eine Antwort zu finden.Der eigentliche Gradmesser einer jeden Demokratie ist die Verfassung. Das russische Problem ist jedoch, wie bereits erwähnt, dass Verfassung und Realpolitik voneinander stark abweichen. Demnach kann, um der Frage nach einer defekten Demokratie nachzugehen, der Blick auf die russische Verfassung nicht genügen, um eine hinreichende Antwort zu finden. Vielmehr ist ein Vergleich von Verfassung und Realpolitik notwendig, um sich der Klärung der Frage zu nähern.Zunächst ist die Klärung, beziehungsweise eine Definition der Begriffe ¿Demokratie¿, ¿defekte Demokratie¿, und ¿Systemtransformation¿ vorzunehmen, um Missverständnissen bei der Interpretation derselben vorzubeugen. Sind diese Begrifflichkeiten geklärt, wird der Prozess des Zerfalls der Sowjetunion erläutert. Darauf folgend die Konstituierung des russischen Staates und die Anwendbarkeit der Transformationstheorie, um etwaige Entscheidungen in der Entstehungsgeschichte Russlands zu finden, die den weiteren Weg Russlands bedingten und möglicherweise als Variablen zu sehen sind, die als strukturelle Grundprobleme Russlands ausschlaggebend für die Frage nach der defekten Demokratie waren.Nach diesem Blick auf die Geschichte Russlands vom Beginn des Transformationsprozesses bis zur Konstitution des russischen Staats wird die russische Verfassung angeschnitten, damit die Frage, ob Russland mit Blick auf die Verfassung als Demokratie zu sehen ist, geklärt werden kann.Ein Blick auf die Realpolitik Russlands wird versuchen, Unterschiede zwischen der russischen Verfassung und der russischen Politik kenntlich zu machen, um besagtes Zitat der zwei Wahrheiten in Russland untermauern oder widerlegen zu können.