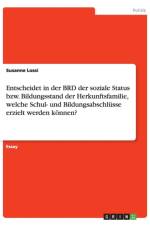von Susanne Lossi
13,99 €
Studienarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich Geschichte Europas - Mittelalter, Frühe Neuzeit, Note: 2,3, Universität der Bundeswehr München, Neubiberg (Historisches Institut), Veranstaltung: Die historische Entwicklung der Staatlichkeit bis 1800, Sprache: Deutsch, Abstract: ¿Es lebte im Reich nur mehr ein schwaches nationalpolitisches Gesamtbewußtsein und ein schwacher Lebenswille der Gesamtheit.¿ 1 Die Problematik, inwiefern das deutsche Reich in den Jahren 1500-1800 ein System komplementärer Staatlichkeit versinnbildlichte und somit der modernen Staatlichkeitsauffassung gerecht wurde, steht im Mittelpunkt der nachfolgenden Betrachtungen.Die Begrifflichkeit des ¿Alten Reiches¿ symbolisiert in diesem Zeitraum ein politisches Ordnungssystem im deutschsprachigen Raum der Frühen Neuzeit, welches auf der Grundlage von gemeinsamer Sprache, Kultur und Abstammung der deutschen Gemeinschaft jene Sicherheit gewährte, um eine nationale Einheit auszubilden und an dessen Spitze das Reichsoberhaupt, in Form von König oder Kaiser stand. Ein charakteristisches Merkmal des ¿Alten Reiches¿ wird durch den Dualismus zwischen der Krone und den Reichsständen versinnbildlicht. Die Reichsstände vereinen sowohl die Fürsten, als auch die einzelnen Territorialherren, welche über die souveräne und unabhängige Hoheitsgewalt in ihrem Gebiet verfügen. Jedoch wird das Reichsoberhaupt, in Gestalt von König bzw. Kaiser als übergeordnete Zentralmacht anerkannt. Innerhalb dieses politischen Machtgefüges kommt es im 15. Jahrhundert zur Reichsreform, dessen Zielsetzung durch die Schaffung einer Verfassungsordnung im ¿Alten Reich¿, welche den Ansprüchen und Bedürfnissen eines frühmodernen Staates entspricht, symbolisiert wird. Auf diese Weise sollten die essentiellen Souveränitätsrechte im gesamten Reichsstaat, entweder unter ständischer oder kaiserlicher Führung vereint werden. Die Reichsreform sollte somit dem stetigen machtpolitischen Antagonismus zwischen König und Ständen entgegenwirken. Die Thematik, die in diesem Zusammenhang aufgeworfen wird, ist die Fragestellung auf welche Art und Weise sich der Reichsstaat zwischen 1500-1800 einer modernen Staatlichkeitsauffassung angleicht. Im Folgenden werden die Verstaatlichungstendenzen auf der Reichsebene, anhand der Entstehung der Reichspublizistik, der Herausbildung des Steuerwesens, am Beispiel des Gemeinen Pfennigs und der Entwicklung einer gemeinsamen Rechtssprechung, am Beispiel des Reichskammergerichtes, dargelegt. Insbesondere werden die Ansichten und Auffassungen des Historikers Georg Schmidt, im Hinblick auf die Entwicklung des ¿Alten Reiches¿ hin zu einem System komplementärer Staatlichkeit, kritisch erörtert.