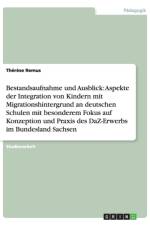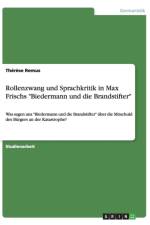- Ein Pladoyer fur postdramatisches Theater im Deutschunterrichts am Beispiel von Rene Polleschs Stuck Kill your Darlings! Streets of Berladelphia
von Therese Remus
17,95 €
Studienarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich Didaktik für das Fach Deutsch - Pädagogik, Sprachwissenschaft, Note: 1,0, Humboldt-Universität zu Berlin (Institut für Germanistik), Veranstaltung: Seminar: Der Text - ein Phänomen im Deutschunterricht, Sprache: Deutsch, Abstract: Ein Blick in den Berliner Rahmenlehrplan für die gymnasiale Oberstufe im Fach Deutsch zeigt, dass das Themenfeld ¿Theater¿ mit durchaus hohen Ansprüchen an Schüler und Lehrer verankert ist. Unter dem Punkt Literatur und Sprache im Kontext anderer Kulturen, Künste und Medien werden die Inhalte ¿Film- und Theatertraditionen in ihren jeweiligen kulturellen Besonderheiten¿, ¿Literatur und Theater im Spannungsfeld zwischen ästhetischem Anspruch, Medien und Publikumserwartungen¿ und ¿Wechselwirkungen zwischen Bildender Kunst, Musik, Film und Literatur¿ konkretisiert. Allerdings setzen diese Lern- und Erkenntnisziele einen Deutschunterricht voraus, der nicht ausschließlich beim dramatischen Text und dessen Interpretation verbleibt. Die Reduktion des Themenfelds ¿Theater¿ auf die Analyse und Interpretation der klassischen Dramentexte ist jedoch größtenteils Unterrichtsrealität. Nach Göbel sei die ausschließliche Fokussierung auf die sprachliche Dimension des Dramas, den dramatischen Lesetext, mediendidaktisch falsch und deshalb fachdidaktisch unverantwortlich. Der Medienwechsel ist für das Drama geradezu konstitutiv. Gabriela Paule setzt diese Forderungen fort und beschreibt eine Zielsetzung für den Deutschunterricht, die sowohl Kompetenzen des Zuschauens als auch des Dramenlesens entwickeln möchte. Um Dramen kompetent lesen und dabei mentale Inszenierungen vornehmen zu können, muss eine Vorstellung von der Spielpraxis des Theaters vorhanden sein, die sich nur durch kontinuierliche Aufführungserfahrungen entwickeln kann. Im Rahmen dieser Arbeit soll mit René Pollesch ein zeitgenössischer Regisseur und Autor in die Diskussion eingeführt werden, dessen Stücke sich m.E. eignen, um oben benannten Desideraten hinsichtlich eines aufführungsbezogenen Dramenunterrichts in der Oberstufe zu begegnen. Erstens erzwingen seine Stücke durch ein eigens verhängtes Nachspielverbot geradezu den Gang ins Theater. Weiterhin kommt man, wendet man sich Polleschs Stücken zu, der Forderung nach, zeitgenössische Kunst in den Deutschunterricht einzubeziehen. Es sollte bedenklich stimmen, dass Frisch und Dürrenmatt noch vielfach die Sparte ¿Gegenwartsdramä repräsentieren. Will man aber Theater nicht als ¿museale Stätte für die Reproduktion von bekannten literarischen Formen¿, sondern als ¿Ort der lebendigen Auseinandersetzung mit Phänomenen und Fragen der Gegenwart¿ vermitteln, muss man sich der Herausforderung des Neuen und Unbekannten stellen.