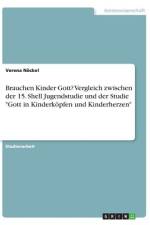von Verena Nöckel
16,95 €
Studienarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich Didaktik für das Fach Deutsch - Pädagogik, Sprachwissenschaft, Note: 1,7, Universität zu Köln (Institut für Deutsche Sprache und Literatur II ), Veranstaltung: Das Rechtschreibgespräch , Sprache: Deutsch, Abstract: Nichts ist subjektiver, als die Beurteilung und Bewertung eines Textes. Esist wissenschaftlich erwiesen, dass derselbe Aufsatz von unterschiedlichenLehrpersonen sehr unterschiedlich beurteilt wird. Das liegt zum einen daran,dass die Textqualität schwer zu erfassen ist, zum anderen an der Tatsache,dass oft das äußere Erscheinungsbild oder die inhaltliche Position stärkerenEinfluss auf die Lehrperson haben. Aus dem Bewerten, dem kognitivenAkt des Einschätzens und dem Beurteilen, der sprachlich geäußertenBewertung gegenüber dem Schüler ergibt sich in der Regel das Benoten, diezusammenfassende Bewertung einer Leistung in einer Ziffernote. Diesegelten aber aus den oben genanten Gründen weder als valide, noch alsreliabel, noch als rein objektiv. Da aber auf die Notengebung nichtverzichtet werden kann, muss man an dem Bewertungsmaßstab arbeiten.Kriterienkataloge sind aber nur sinnvoll, wenn sie grundsätzlich von alleneingehalten werden und keine Überzahl an Kriterien entsteht. IngridBöttcher und Michael Becker-Mrotzek haben hierzu einen Basiskatalogentwickelt, der 12 Kriterien umfasst und 5 Dimensionen für dieAufsatzbeurteilung herausstellt. Wenn man nun also einen festgelegtenKriterienkatalog hat, dann könnte man diesen auch als allgemein gültigesMessinstrument verwenden.Ist es daher nicht sinnvoll, wenn die Schülerinnen und Schüler den Schrittder Bewertung selber gehen, also schon vor der Abgabe ihre Aufsätzekontrollieren können?Eine geeignete Methode für das Bewerten eines Schüleraufsatzes ist dieSchreibkonferenz. Der selbstverfasste Text wir einer kleinen kritischenÖffentlichkeit präsentiert, damit der Verfasser möglichst vielseitigeRückmeldungen bekommt, der ihn dann veranlasst seinen Text zuüberarbeiten. Brakel-Olsen hat 1990 in einer Studie herausgestellt, dass dieQuantität der Überarbeitungen ohne Beteiligung der Mitschüler zwar höherwar, jedoch meist nur die Oberfläche des Textes betrafen.[...]