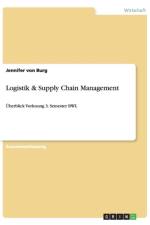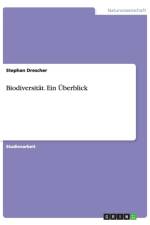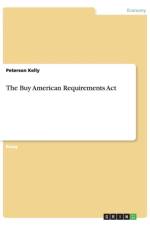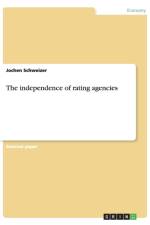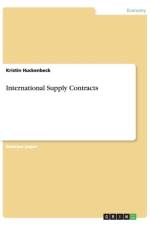von Christoph Hendrichs
15,95 €
Studienarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich Weltgeschichte - Frühgeschichte, Antike, Note: 1,7, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Sprache: Deutsch, Abstract: Das Konzil von Ephesus aus dem Jahre 431 festigte die Auffassung der katholischen Überlieferung zur Frage nach der Menschwerdung Jesu Christi und beeinflusste die Position der Kirche zu dieser Frage nachhaltig. Ausschlaggebend hierfür waren die Ausführungen des konzilsleitenden Bischofs Cyrill von Alexandrien, der sich bereits im Vorfeld des Konzils mit Nestorius, dem Patriarchen von Konstantinopel, per Briefwechsel darüber stritt, ob die heilige Jungfrau Maria als ¿theotokos¿ (zu deutsch: ¿Gottesgebärerin¿) oder lediglich als ¿christotokos¿ (zu deutsch: ¿Christusgebärerin¿) bezeichnet werden durfte. Während dieser Auseinandersetzungen agierte Cyrill heftig gegen Nestorius, indem er nicht nur ihm, sondern auch dem Bischof von Rom, anderen hohen Kirchenvertretern und weltlichen Herrschern Briefe schrieb, in denen er um Unterstützung gegen Nestorius bat. Zudem verfasste er fünf Bücher ¿Gegen die Gotteslästerungen des Nestorius¿. Das Konzil, das von Kaiser Theodosius II. einberufen wurde, um diese Streitigkeiten beizulegen, war durch Ungerechtigkeiten gegenüber Nestorius gekennzeichnet. So eröffnete Cyrill das Konzil vorzeitig und noch bevor die Bischöfe Antiochiens eintrafen, die sich wohl auf Nestorius' Seite gestellt hätten. Auf diese Weise erreichte er schließlich eine Mehrheit an Stimmen, die sich für eine Absetzung des Nestorius' einsetzten.Vor dem Hintergrund dieser Ereignisse wirft sich die Frage auf, warum Cyrill bei den Streitigkeiten um die Menschwerdung Jesu Christi derart übereilt und ungerecht handelte. In der vorliegenden Arbeit soll diskutiert werden, ob persönliche und kirchenpolitische Motive sein Handeln beeinflusst haben könnten oder ob sein Handeln mit aufrichtigem Eifer für den Glauben zu erklären ist. Dies wird zum einen auf Grundlage des Werkes ¿liber heraclidis¿ von Nestorius geschehen, in dem er Cyrill aus dem Exil heraus unaufrichtige und inhaltsferne Motive bezüglich der Streitigkeiten unterstellte. Da dieses Werk als Verteidigungsschrift aus Sicht des verurteilten Nestorius verfasst wurde, werden diese Anklagen anhand anderer Quellen auf ihren Gehalt hin geprüft. Zum anderen stützt sich die Arbeit auf den Briefwechsel, der zwischen Nestorius und Cyrill stattfand, und der Aufschluss über die Ansichten beider Parteien gibt. Es wird untersucht, ob aus den Inhalten des Streits Schlüsse gezogen werden können, die das übereifrige Handeln Cyrills erklären und einen Eifer für den Glauben als Motiv nachweisen können.