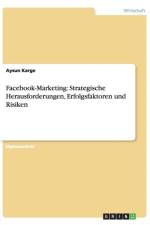von Rajko Dikmann
16,95 €
Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Politik - Internationale Politik - Region: Südosteuropa, Balkan, Note: 2,0, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Sprache: Deutsch, Abstract: Im ¿Büyük Han¿, der ¿Großen Herberge¿, treffen sich wöchentlich Menschen aus dem Norden und Süden der Insel Zypern. Männer aus dem türkischen und griechischen Teil der letzten geteilten Hauptstadt der Welt, Nikosia, finden sich zum Stammtisch ein, um sich über Möglichkeiten zur Überwindung der Teilung Zyperns zu beraten. Gegründet wurde der Stammtisch 2004, in jenem Jahr, in dem der ¿Annan Plan¿ zur Wiedervereinigung des griechischsprachigen Südteils mit dem türkischsprachigen Nordteil Zyperns in einer Volksabstimmung an der Ablehnung des griechischen Teils Zyperns scheiterte. Auf der Suche nach einer Art der Koexistenz gilt im ¿Büyük Han¿ die Regel: Zu viel Geschichte, zu viel Politik ist tabu. Um die fragilen freundschaftlichen Verhältnisse nicht zu gefährden, wird bei zu ernsten Gesprächsthemen ein Lied angestimmt, was einen sofortigen Wechsel des Gesprächsthemas signalisieren soll. Woche für Woche werden Lieder angestimmt, um auf dem beschwerlichen Weg zur Gleichberechtigung nicht ins stolpern zu geraten, damit jener alte Traum, die Wiedervereinigung der beiden Inselteile zur ¿Vereinigten Republik Zypern¿, nicht bloß vage Hoffnung der Vergangenheit bleibt. (Vgl.: Spiegel.de 21.04.07) Diese Hausarbeit hat das Ziel, jene Spaltung Zyperns in einen türkischsprachigen Nordteil und einen griechischsprachigen Südteil zu analysieren und zu erklären. Dabei ist das Scheitern des Annan-Plans aus dem Jahre 2004 nur als Wegpunkt in der zypriotischen Geschichte anzusehen, dessen Ursachen weit vorher gesucht werden müssen. Bevor jedoch mit der Suche nach den Ursachen für jene Spaltung begonnen werden kann, muss sich jene Suche auf einen Blickwinkel, also eine Theorie beschränken, mit deren Hilfe ein Blick auf die Historie geworfen werden kann. So wird in dieser Arbeit mit dem Ansatz von Effinger, Rittberger und Zürn gearbeitet, deren ¿Beitrag zur Erforschung der friedlichen Behandlung internationaler Konflikte¿ als Grundlage zur Analyse des Zypernkonflikts genommen werden soll. Zunächst wird der besagte Ansatz vorgestellt und erläutert, um darauf folgend im zweiten Teil auf den historischen Verlauf des Konfliktes einzugehen. Im Folgenden soll dann durch die Anwendung des Ansatzes von Effinger, Rittberger und Zürn der Konflikt analysiert werden, um entscheidende Wegpunkte, Gruppierungen und Positionen in der Geschichte des Konflikts kenntlich zu machen.