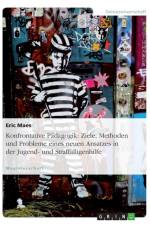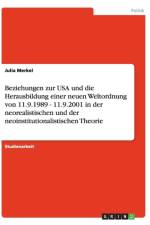von Sabine Steffan
47,95 €
Diplomarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Pflegewissenschaft - Pflegemanagement, Note: 1,0, Alice-Salomon Hochschule Berlin , Sprache: Deutsch, Abstract: Für diese Diplomarbeit wurde Anfang des Jahres 2006 eine standardisierte Befragung von Pflegemitarbeiterinnen in stationären Pflegeeinrichtungen hinsichtlich ihrer Einstellung zur IT-gestützten Pflegedokumentation durchgeführt. Von den 1402 versandten Fragebögen, die an 61 stationäre Pflegeeinrichtungen versandt wurden, wurden n=385 Fragebögen zurückgesandt. Der Rücklauf der Fragebögen lag somit bei 27,5% und ist dabei in einer vergleichbaren Größenordnung ähnlicher Studien. Die Auswertung der Befragung erfolgte unter Verwendung des Statistikprogramm SPSS Version 12.0. Wobei für die Datenanalyse deskriptive , explorative und konfirmatorische Methoden verwendet wurden. Ziel der Arbeit war es, darzustellen, wie die Pflegemitarbeiterinnen mit dem Computer umgehen können und ihre Einstellungen zur IT-gestützten Pflegedokumentation sind. Ebenso interessierte, welche Defizite es gibt zwischen dem technisch-möglichen und der Realität. In den Ergebnissen der Befragung wurde eine überwiegend positive Einstellung der Pflegemitarbeiterinnen hinsichtlich des Umganges mit dem Computer als auch einer IT-gestützten Pflegedokumentation festgestellt. So kann der Aussage von Goosen (1998:41): ¿Viele Pflegende haben wenig Interesse am Umgang mit dem Computer.¿, nicht mehr zugestimmt werden. Auffällig hingegen waren die Aussagen zu den Computerarbeitsplätzen und der mobilen Dokumentation, denn über zwei Drittel der Befragten finden zu wenige Computerarbeitsplätze vor oder es fehlen mobile Eingabegeräte. Zusätzlich zu den Einstellungen zur Technik wurde nach der Vereinheitlichung der Pflegefachsprache unter Verwendung von Klassifikationen wie z.B. die ICNP, NANDA, NIC oder NOC gefragt. Diese werden von nur 7,8 % der befragten Pflegemitarbeiterinnen genutzt. Ein Großteil der Befragten kennt keine Pflegeklassifikationen. Das Wissen bzw. die Anwendung einer vereinheitlichten Pflegefachsprache ist aber wichtig, um aus den im Softwareprogramm hinterlegten Katalogen und den Eingaben zur IT-gestützten Pflegedokumentation sinnvolle Kennzahlen für das Pflegemanagement, das Controlling oder das Benchmarking zu generieren. Dieses Wissen könnte, wie Trill bereits 1993 (S.12) meinte, bereits durch die Ausbildung (Schule, Berufsausbildung) und Weiterbildung¿ sowie Schulungen vor Ort vermittelt werden.