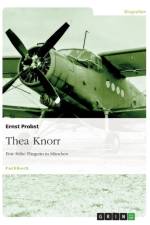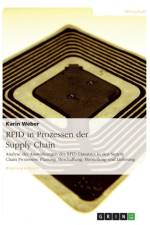von Juliane Trebus
47,95 €
Magisterarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich Didaktik für das Fach Deutsch - Pädagogik, Sprachwissenschaft, Note: 2,3, Humboldt-Universität zu Berlin, Sprache: Deutsch, Abstract: Seit jeher hat das Außergewöhnliche eine starke Anziehungskraft auf den Menschen. Auch zeitgenössische Entwicklungen in Literatur und Kunst zeigen, dass es in seiner Natur liegt, immer wieder nach Wegen zu suchen, das ihm Unbegreifliche zu erklären. Eine Erklärungsstrategie stellt die Phantastik und Fantasyliteratur dar, welche das Übernatürliche konkret thematisiert und, ersichtlich an Verfilmungen wie The Lord of the Rings, The Chronicles of Narnia und nicht zuletzt Harry Potter, erneut an Beliebtheit zugenommen hat. Gerade diese Popularität ist es aber, die den Argwohn der akademischen Seite hervorruft. So wird oft angenommen, "the fantastic is [...] a form of literature not fit for serious study." Die große Beliebtheit dieser Literaturform sollte aber gerade ein Grund sein, sich mit den Ursachen dafür auseinanderzusetzen. Joanne K. Rowlings Harry-Potter-Reihe, ist mittlerweile "von den Kultur- in die Gesellschaftsabteilungen übergelaufen". Ihr außerordentlicher Erfolg ist aber keineswegs nur geschickt angewendeten Marketingstrategien zu verdanken, sondern auch ihrer textinternen Beschaffenheit. Diese Ursachen für ihre enorme Popularität zu ergründen, wurden die Harry-Potter-Bücher für die vorliegende Arbeit ausgewählt. Mittlerweile gibt es auch einige Forschungsliteratur, welche die Romane vor allem psychologisch und soziologisch auf ihre Wirkung hin betrachten. Neben diesen Aspekten soll der Text hier überwiegend literaturwissenschaftlich untersucht werden. Er ist jedoch nicht nur phantastische, sondern auch Kinder- und Jugendliteratur, was es umso bemerkenswerter macht, dass sich weltweit mit diesem Phänomen auseinandergesetzt wird. Deshalb soll in der vorliegenden Arbeit auch die textimmanente Pädagogik erörtert werden. Da "kein Text [...] wirklich einzigartig, vollkommen originell [, sondern immer] ein Geflecht von literarischen Bezügen" ist, lassen sich in der Regel wiederkehrende Strukturen ausmachen, die ihn einem bestimmten Genre zuordnen. In diesem Fall gilt es zunächst, die Phantastik zu definieren und ihre wichtigsten Strukturen, Zwei-Welten-Modell, Magie und Konfliktbewältigung, herauszuarbeiten. Danach soll sich den Merkmalen der Kinder- und Jugendliteratur gewidmet und ihre Verknüpfung mit dem Phantastischen sowie der pädagogische Aspekt dargelegt werden.[...]