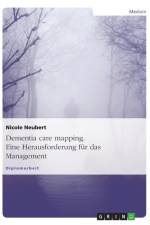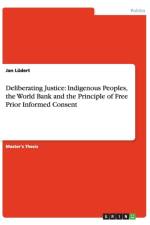von Jorg Leistenschneider & J Rg Leistenschneider
17,95 €
Studienarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich Didaktik - Sport, Sportpädagogik, Note: 1,5, Universität Karlsruhe (TH) (Institut für Sport und Sportwissenschaft), Veranstaltung: Sportpädagogik, Sprache: Deutsch, Abstract: An den heutigen Schulen kennzeichnen Heterogenität und Vielfalt den Schulalltag und erfordern innovative Ideen. Alternativen zum traditionellen Sportunterricht rücken in das Blickfeld der Sportlehrer, um den gesellschaftlichen Anforderungen gerecht zu werden. Im Zuge der geforderten Qualitätsentwicklung kommen den neuen Unterrichtsformen immer höhere Stellenwerte zu. Offener Unterricht ist dabei eines, der immer wieder vorkommenden Schlagworte. Dazu zählen unter anderem Gruppenarbeit, Projektarbeit und freie Arbeit. Synonym zum offenen Unterricht werden in der Literatur auch Begriffe wie problemorientierter, handlungsorientierter, schülerorientierter, prozessorientierter oder auch erziehender Unterricht genannt. Bisher werden diese neuen Unterrichtsformen jedoch nur zaghaft eingesetzt. Dabei weckt der offene Sportunterricht gleichermaßen Hoffnungen und Abneigung. Hoffnungen, dass neue Unterrichtsformen schulische Langweile und schulischen Alltagsstress überwinden helfen, indem Schüler aktiver am Unterrichtsgeschehen teilnehmen, sodass sie insgesamt mehr Lernbereitschaft und Interesse entwickeln. Abneigung, weil man befürchtet, dass die pädagogischen Ansprüche in der Praxis nicht einlösbar sind und mit dem Postulat ¿Offenheit¿, zugleich Beliebigkeit und Planlosigkeit miteinziehen (vgl. Frankfurter Arbeitsgruppe, 1994, S.9). Unstrittig ist dabei, dass es den perfekten Unterricht und die ideale Lernmethode nicht gibt. Denn verschiedene Ziele erfordern verschiedene Verfahren und Methoden. Auf Grund ihrer emotionalen und motivalen Voraussetzungen sind die Wirkungen bei den Schülern sehr unterschiedlich.Der Lehrende kann dabei lediglich die Ziele definieren, ob diese jedoch von den Schülern angenommen werden, bleibt abzuwarten. Letztendlich gestaltet sich der Lernprozess in hohem Maße vom Schüler selbst bestimmt und weit weniger, als bisher von Lehrerseite angenommen, fremdbestimmt (vgl. Lipinski, 2005, S.12.).