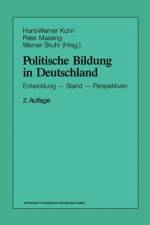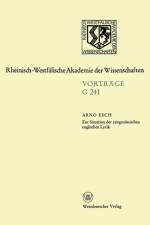- Entwicklung Und Strukur Des Politischen Systems
von Professor Michael Wolffsohn
74,99 €
Israel ist ein wichtiger Akteur in den Nahost-Konflikten. Auch eine Studie tiber Politik in Israel beriihrt diese Auseinandersetzung teils direkt, teils indirekt. Deshalb muB ich als Autor dieser Studie Stellung beziehen, Flagge zeigen. Vor allem die wissen schaftliche Redlichkeit gebietet es. leh gestehe, daB meine Sympathien auf der Seite Israels sind. Nicht zuletzt ist dies durch meine Herkunft bedingt. Zugleich erkenne ich, so hoffe ich wenigstens, Starken und Schwachen des Zionismus, des Jtidischen Staates und seiner Politik sowie das Leid, das Arabern, aber auch Israelis, angetan wurde. Ich analysiere Politik, ich bin kein Propagandist, und eine normative Verengung der Analyse lehne ich ab, halte ich flir unwissenschaftlich. Grundsiitzlich sollte die vor liegende Arbeit flir Freunde und Gegner Israels gleich wertvoll (hoffentlich)oder wertlos sein. Habe ich gegen diesen Grundsatz verstoBen, moge mich der Leser tadeln; ich stimme ihm zu. Ich halte den Jtidischen Staat flir legitim. Ich bin daflir, ihm jede Untersttitzung zu gewahren, die er flir die Sicherung seiner Existenz benotigt. Ich bin der Meinung, daB es ihn als etwaiges Asyl ebenso wie als alternative jtidische Lebensform geben muB, selbst wenn die Mehrheit der Juden in der Welt heute (und wohl auch in absehbarer Zukunft) nicht in Israellebt.