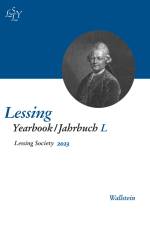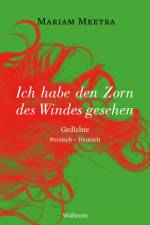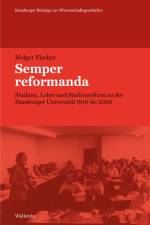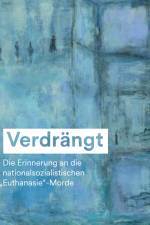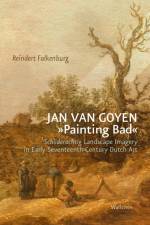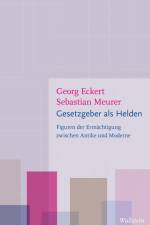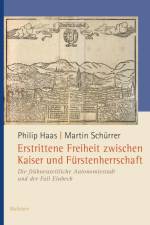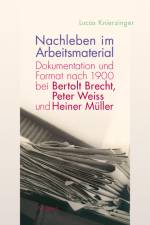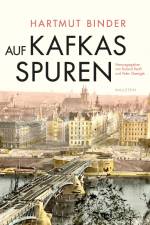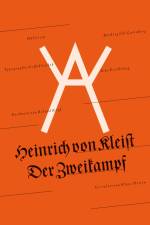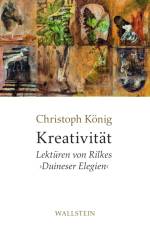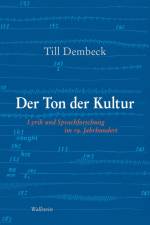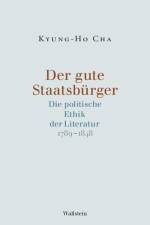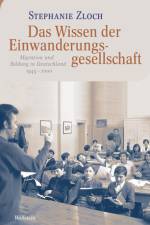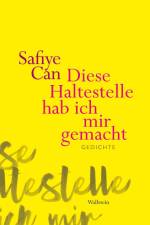von Ofer Waldman
22,00 €
Aus dem dünnen Spalt zwischen der Einsamkeit des Übungsraums und der Anonymität der Orchesterreihen erscheinen Fantasien, Beobachtungen, gesellschaftliche Aphorismen.Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Den Rausch, die Angst, den Herzschlag, den Atem, das Gefühl, die Hitze. Mit diesen Worten taucht »Singularkollektiv« in eine Welt, die jenseits des Glamours liegt, der gewöhnlich mit klassischer Musik verbunden wird. Eine Welt unter der dünnen Schicht von Frack und Fliege, in der das Orchester einer weiten Steppe gleicht, einem bahnhofslosen Ort. Wo es nach Blech und Öl, Holz und Schweiß riecht. Aus dem dünnen Spalt zwischen der Einsamkeit des Übungsraums und der Anonymität der Orchesterreihen, zwischen Musikbeamtentum und brotloser Kunst, dringen Fantasien, Beobachtungen, gesellschaftliche Aphorismen nach außen. Die Geigerin, die so tut, als ob sie spielt und ihre stille Kunst feiert, der abgelehnte Posaunist, der um die Gunst eines neuen Generalmusikdirektors bangt. Der schlechte Cellist, der an seinem Cello wie ein Schiffbrüchiger hängt, der verspätete Geiger, auf den nicht gewartet wird. Die Scheinrealität einer Generalprobe. Die ungewöhnlichen Instrumente, die es in den Orchesterkanon nicht geschafft haben. Figuren und Momente, die der Orchesterwelt entstammen, aus dieser gleichzeitig herausragen als menschliche, gesellschaftliche Kommentare.