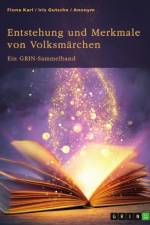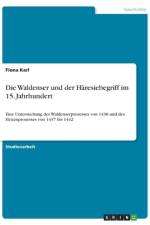von Fiona Karl
15,95 €
Studienarbeit aus dem Jahr 2020 im Fachbereich Weltgeschichte - Frühgeschichte, Antike, Note: 1,3, Universität Trier (Alte Geschichte), Sprache: Deutsch, Abstract: Der Feldzug Caesars gegen die Helvetier, auch Bellum Helveticum genannt, kann als Startpunkt des Gallischen Krieges betrachtet werden. Caesar hat hier zum ersten Mal auf gallischem Boden militärische Aktionen veranlasst, die nicht nur zur reinen Verteidigung der römischen Provinz Gallia Transalpina und zum Schutz der Verbündeten Roms gedient haben, auch wenn Caesar es durchaus vermochte, in seinen commentarii de Bello Gallico die Leserschaft vom Gegenteil zu überzeugen. Und genau dieser Streitpunkt wird in der Forschung immer wieder aufgegriffen: Da die einzelnen Bücher des Bellum Gallicum von Caesar selbst verfasst wurden und die parallelüberlieferten Quellen zum Gallischen Krieg eher dürftig ausfallen, ist eine multiperspektivische Herangehensweise zur Ermittlung der Authentizität der Darstellung Caesars so gut wie unmöglich. Fest steht aber, dass Caesar als Autor und Protagonist des Bellum Gallicum diesen aus bestimmten Gründen so dargestellt hat, wie es in Caes. Gall. zu lesen ist. Ein Teil davon ist eben der Bellum Helveticum, dessen Auslöser, Verlauf und Ausgang in Caes. Gall. 1, 1-29 beschrieben und ¿ vor allem ¿ begründet werden. Welche Ereignisse und Gründe dazu führten, dass Caesar den Feldzug gegen die Helvetier antrat und wie er eben diesen in Caes. Gall. 1, 1-29 rechtfertigt, sollen in dieser Hausarbeit herausgestellt werden. In erster Linie ist es hier wichtig zu untersuchen, wieso Caesar überhaupt in die Provinz abgezogen ist. War ihm von Anfang an klar, dass sich eine Auseinandersetzung mit den Helvetiern bieten würde, die er nutzen könnte? Und welche Rollen spielten dabei die innenpolitische Stellung Caesars, sein Wesen und sein beständiger Wunsch nach militärischem Erfolg? Im zweiten Schritt soll Caes. Gall. 1,1-29 analysiert werden. Wie beschreibt Caesar hier die Ereignisse des Jahres 58 v. Chr. und wie begründet er seine Entscheidungen? Es ist klar, dass Caesar seine Beschlüsse als unumgänglich darstellen muss, doch welcher Rechtfertigungsstrategien bedient er sich hier? Hier ist die Betrachtung der Darstellungsweise der Helvetier immanent. Zum Schluss stellt sich die Frage, ob Caesars Begründungen wohl ausgereicht haben, um die Römische Republik von der Gerechtigkeit seines Krieges zu überzeugen.