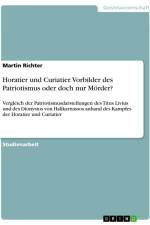von Martin Richter
15,95 €
Studienarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich Weltgeschichte - Altertum, Note: 2,0, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Sprache: Deutsch, Abstract: In dieser Arbeit soll das Auftreten Ere¿kigals in den Mythen ¿Nergal und Ere¿kigal¿, ¿Inannas/I¿tars Gang in die Unterwelt¿ und dem ¿Gilgame¿-Epos¿ untersucht werden, mit der vordergründigen Frage ob sie als abscheuliches Monster oder doch als ganz ¿normale¿ Göttin dargestellt wird. Hinzu kommt die Frage, wie es den Akteuren der Mythen gelang aus der Unterwelt wieder zu entkommen und der Macht der Ere¿kigal zu entrinnen. Des Weiteren soll die Unterwelt an sich auch kurze Beachtung finden, vor allem in Bezug auf ihre wichtigsten Bewohner, ihre Topographie und ihrem Aussehen, sowie dem Leben ihrer Bewohner. Im mesopotamischen Glauben war die Unterwelt keinesfalls ein Ort des Chaos, in den die Verstorbenen nach ihrem Tod gegangen sind. Sie war vielmehr eine geordnete ¿Welt¿, in der aber kein vergleichbarer Lebensstandard vorherrschte wie in der oberirdischen Welt. Ihr konnte im Grunde keiner entkommen. Selbst unsterbliche Götter konnten ihr eigentlich nicht entrinnen, wodurch sie immer über ihre Boten, für die dies nicht galt, zur Kommunikation mit der Unterwelt benutzten. Für Ere¿kigal war die Situation nicht viel anders. Sie konnte nicht die oberirdische Welt betreten, weshalb sie mit Hilfe ihres Boten Namtar, mit den oberirdischen Göttern in Verbindung trat. Die jenseitige Welt ist ein ¿Haus der Finsternis¿, ¿ein Haus, dessen Bewohner des Lichtes entbehren¿. Da es, wie bereits erwähnt, von diesem Ort kein Entrinnen gab, nannte man ihn auch kurnugi ¿das Land ohne Wiederkehr¿. Andere Namen waren aber auch ¿das Haus des Geschickes¿ eines jeden Menschen, ¿das große Haus¿, ¿die Totenstadt¿ oder auch ¿das Haus des Staubes¿. Gelegentlich ist auch der Name Kutha zu finden, welches die Nekropole der Stadt Babylon war. Hier befand sich auch der Tempel der Ere¿kigal é.eri.gal, das ¿Haus der großen Stadt¿. Ere¿kigal nun war die Herrin der Unterwelt oder wie ihr sumerischer Name, Ere¿-ki-gal bereits sagt, die ¿Herrin des großen Landes¿. Ihr Auftreten in mesopotamischen Mythen und Epen ist zahlreich, aber vor allem im Zusammenhang mit dem Unterweltsgang einer bestimmten Person oder eines Gottes. Andere Namen für sie waren im Laufe der Zeit Al-la-tum, Ama-áb-zi-kur-ra, Gäan-ki-gal, Gù-a-nu-si und Kù-an-ni-si. Sie ist die Gemahlin des Nergal und des Nin-azu. Der Sohn, den sie mit Enlil hat, ist Namtar, welcher gleichzeitig ihr Bote und Wesir ist. Außerdem hat sie eine Tochter Nungalla.