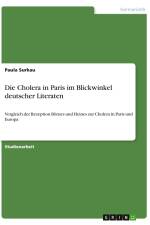von Paula Surkau
18,95 €
Studienarbeit aus dem Jahr 2023 im Fachbereich Germanistik - Linguistik, Note: 1,0, Universität Potsdam (Germanistik), Veranstaltung: Linguistic Landscapes, Sprache: Deutsch, Abstract: Berlin ist eine internationale, multikulturelle Stadt, die stark durch die Heterogenität von sozio-demografischen Merkmalen wie Alter, Geschlecht, Weltanschauung, und ethnisch-kulturelle Identität geprägt ist. Menschen mit verschieden Hintergründen leben mehr oder weniger gemeinsam in diesem urbanen Raum. Dabei stellen die U-Bahnhöfe Berlins einen besonderen Knotenpunkt des sozialen Miteinanders dar. Die Gruppe der Nutzer*innen ist heterogen und gleichzeitig mit der Lokalität verbunden. Dabei werden U-Bahnhöfe nicht nur als Aufenthaltsort, sondern auch als Ort der Kommunikation genutzt. Sie sind gefüllt mit Zeichen ¿ viele davon sind ohne Autorisierung angebracht. Medien berichten von ¿Vandalismus-Schock¿ und ¿Graffiti-Schmierereien¿. Die nicht-autorisiert angebrachten Zeichen werden als störend und negativ betrachtet. Gleichzeitig enthalten sie verschiedene Arten der Meinungsäußerung und können Ausdruck politischer und gesellschaftskritischer Identität sein. In der folgenden Arbeit sollen sie nicht als Störfaktor, sondern als Ressource der Sprachlandschaft einer politisch aktiven Gesellschaft betrachtet werden. Es soll untersucht werden, inwieweit die Äußerungen der Graffiti die politischen Haltungen, verschiedener Bevölkerungsgruppen widerspiegelt.Als Untersuchungsorte dienen hier die Ortsteile Steglitz, Schöneberg und Charlottenburg, wobei Graffiti an ihren sozialen Knotenpunkten, den U-Bahnhöfen, untersucht werden. Die Fragestellung ist dabei: Wie präsentieren sich politische Äußerungen in den Linguistic Landcapes der Berliner U-Bahnhöfe und inwieweit repräsentieren diese die politischen Ansichten der Ortsteile? Um diese Frage zu beantworten, wird einleitend die Bedeutung der Linguistic Landscapes und die der transgressiven Zeichen in Bezug auf sozio-politische Dimensionen dargestellt. Dann wird die sozio-demografische und politische Situation der Untersuchungsgebiete gezeigt, wobei U-Bahnhöfe als Diskursraum vorgestellt werden. Es werden einige Beispiele zu politischen Graffiti aus den untersuchten U-Bahnhöfen im Hinblick auf den dargestellten politischen Diskurs analysiert und infolgedessen mit den bestehenden politischen Haltungen in den Ortsteilen verglichen. Dies soll Aufschluss auf die Frage, inwieweit sind politische Haltungen in den Graffiti Berliner U-Bahnhöfe repräsentiert sind, geben.