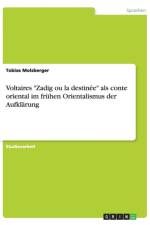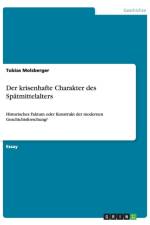- Eine sprachwissenschaftliche Erlauterung
von Tobias Molsberger
17,95 €
Studienarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich Französische Philologie - Linguistik, Note: 3,0, Justus-Liebig-Universität Gießen (Institut für Romanistik), Veranstaltung: Französische Syntax, Sprache: Deutsch, Abstract: Der Dativ wird im Französischen anders realisiert als im Deutschen. Ein Beispiel hierfür ist folgender Satz: ¿Die Verfassung hat den Frauen das Wahlrecht gegeben¿. Wörtlich übersetzt hieße dieser Satz im Französischen * La constitution a les femmes le droit de voter donné. Richtigerweise muss es allerdings heißen: La constitution a donné le droit de voter aux femmes. Während im Französischen beispielsweise eine Präposition wie de oder á zur Realisierung des Dativs gebraucht wird, gibt es dies im Deutschen nicht. Im Deutschen wird das Subjekt dekliniert, vor allem im Nominativ-Fall, sodass herauskommt, dass lediglich der Nominativ durch die Nominalgruppe in Verbindung mit dessen Deklination erkennbar wird. Im Gegensatz dazu werden die anderen Fälle, also Genetiv, Akkusativ und der Dativ durch einen entsprechenden Artikel wie ¿dem, deren, dessen¿, oder ¿den¿ realisiert und lassen sich durch die entsprechenden Fragen (¿Wessen? / Wen oder Was? / Wem oder Was?¿) bestimmen. Die Satzstruktur des Deutschen entspricht im Großen und Ganzen derjenigen des Französischen, was bedeutet, dass das Nomen bevorzugt ebenfalls vor dem Verb erscheint, mit dem signifikanten Unterschied des Dativs anstelle des Akkusativs. (Muller 2008: 179)Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Dativ im Französischen. Die Frage, die gestellt werden müsste um den Dativ in einem französischen Satz herauszufiltern wäre ungefähr, im Gegensatz zur ¿Wem-oder-Was-Frage¿ im Deutschen, ¿à qui / de qui / chez qui / à quoi / de quoi/¿?¿. Ziel dieser Arbeit ist es, den Dativ aus der Sicht verschiedener französischer und nichtfranzösischer frankophoner Sprachwissenschaftler genauer zu beleuchten. Dazu wird zunächst ein Überblick über die Verbergänzungen gegeben, begonnen mit einem Kontrast der transitiven und intransitiven Verben sowie der direkten Objekteergänzung. Darauf folgt der Hauptteil dieser Art, nämlich der Dativ im Französischen, indem zunächst eine allgemeine Beschreibung der indirekten Objektergänzung oder Dativ-Objektergänzung getätigt wird. Es folgt eine Analyse der verschiedenen Ausprägungen des Dativs im Französischen mit der Analyse der entsprechenden Besonderheiten. Beispielsätze, die mit Sternchen (*) versehen sind, sind falsch.Eine Zusammenfassung der Ergebnisse am Ende der Arbeit soll diese in Verbindung mit einem kurzen Ausblick auf die zukünftige Vermittlung der Fremdsprache des Autors an einer Schule, das heißt das Lehren von Schülern, abrunden.