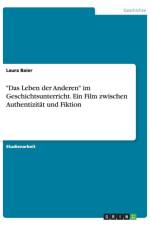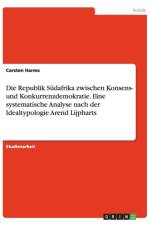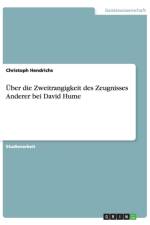von Daniel Schroeder
15,95 €
Studienarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich Didaktik für das Fach Englisch - Pädagogik, Sprachwissenschaft, Note: 2,0, Universität Rostock (Institut für Anglistik/Amerikanistik), Veranstaltung: Englischunterricht zwischen Aneignung und Vermittlung, Sprache: Deutsch, Abstract: Viele junge Lehrer sind aktive User in Internet-Foren , bei denen sie ihre Eindrücke vom eigenen Unterricht wiedergeben und nach Hilfe suchen können, falls es in der Schule nicht so läuft, wie sie es sich vorstellen. Erschreckend ist wenn man liest, dass einige ihren eigenen Englischunterricht langweilig finden. Wenn Letzteres der Fall ist, werden die Schüler ihn wohl kaum spannend finden und daraus resultierendes Desinteresse führt zu schlechter werdenden Leistungen. Ein Grund dafür, dass der Englischunterricht langweilig werden könnte, ist, wenn er in der Schule kaum handlungsorientiert praktiziert wird. Wenn man als Schüler ständig mit dem Lehrbuch, bei dem fast jedes Kapitel gleich aufgebaut ist , arbeiten muss, verwundert es nicht, dass keine Begeisterung aufkommt, wenn es um das Fach Englisch geht. Dazu kommt, dass der Grammatikunterricht nicht zu kurz kommen darf und ausgiebig behandelt werden muss. Letzterer trifft ja auch schon im Fach Deutsch auf Ablehnung. ¿Wieso kämpfen Lehrwerke, Lehrerinnen und Lehrer mit allen möglichen Tricks, um Lernende ¿ wenn sie sie schon nicht interessieren können ¿ wenigstens zum Stillhalten zu bewegen, wenn die grammatische Dimension der Sprache thematisiert wird¿ (Boettcher: 2009, XI)?Viele Schüler finden Grammatik langweilig, was zum einen daran liegt, dass ihnen nicht deutlich gemacht wird, wozu sie sie brauchen und wieso das Untersuchen der Sprache so wichtig ist, und zum anderen, weil der sonstige Unterricht ebenfalls nicht handlungsorientiert praktiziert wird. Letzteres trifft nicht auf den Projektunterricht zu, denn bei der Projektarbeit müssen die Schüler selbstständig arbeiten und der Lehrer fungiert als Lernbegleiter und nicht ausschließlich als Wissensvermittler, der den Lehrstoff den Schülern frontal erklärt. Natürlich kann der Englischunterricht nicht dauerhaft durch Projektarbeit realisiert werden. Letzteres stellt jedoch eine interessante Methode dar, die viel Abwechslung in den Unterricht bringen und die Schüler zum Lernen der Sprache motivieren kann, sodass sie im Anschluss auch mehr Begeisterung für den grammatikalischen Teil der Lehreinheit zeigen könnten. Die englische Sprache wird am besten in der Praxis gelernt und die Projektarbeit bietet Möglichkeiten zur Anwendung. Es ist nämlich wichtig, dass die heutigen Schüler sich für Englisch interessieren, da diese Sprache durch die voranschreitende Globalisierung immer mehr an Bedeutung zunimmt.