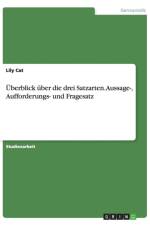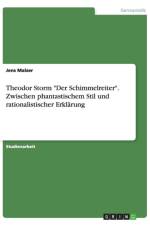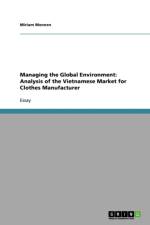- Legenden oder Wirklichkeit?
von Florian Kalk
15,95 €
Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Weltgeschichte - Frühgeschichte, Antike, Note: 2,7, Universität Paderborn (Historisches Institut), Veranstaltung: Einführung in die alte Geschichte ¿ Von der Gesellschaft zum Staat: Das Beispiel Athen, Sprache: Deutsch, Abstract: Laut Athenaios, hätte Solon ein Gesetz erlassen, dass den Männern verbot im Parfümgewerbe zu arbeiten. Dieser behauptet auch, dass Solon die damalige Form der Prostitution durch Gesetze reglementiert und veränderte hätte. Da diese Darstellungen jedoch erstmals ca. 800 Jahre nach Solons Lebzeiten bei Athenaios auftauchten und sie zuvor weder bei Aristoteles noch bei sonst einem bekannten Schriftsteller Beachtung gefunden hatten, wird die Frage aufgeworfen, ob diese Gesetze wirklich von dem berühmten Gesetzesvater Athens stammen oder Athenaios sie ihm nur fälschlicher Weise zugeschrieben hat? Um dies zu überprüfen, werde ich die Gesetze bei Athenaios analysieren und versuchen dessen Intention herauszuarbeiten. Weiterhin werde ich versuchen Quellen zu finden in denen die Gesetze ebenfalls erwähnt werden. Außerdem muss Solons Einstellung von Luxus dargestellt werden, damit eine glaubwürdige Einschätzung seiner Einstellung zum Reichtum möglicherweise Aufschluss über die Wahrheit der Gesetze geben kann. Diese Vorgehensweise soll mir dabei helfen zu beantworten, ob Solons Luxusgesetze über die Prostitution und den Parfümgebrauch Legenden oder Wirklichkeit sind.Zwar haben sich schon diverse Wissenschaftler mit den beiden Gesetzen im Hinblick auf Solons Luxusgesetzgebung beschäftigt, doch gehen die Meinungen über die Echtheit auseinander. In dieser Arbeit wird in der Auseinandersetzung mit verschiedenen Quellen, sowie unter Berücksichtigung der das Thema betreffenden wissenschaftlichen Literatur nachzuweisen sein, dass die Gesetze nicht echt sein können. Wichtig für die Bearbeitung der Fragestellung erwiesen sich hierbei neben Quellen von Athenaios, Solon, und Plutarch, Monographien von R. Bernhard , C. Reinsberg und L. de Blois, der Aufsatz von M. Fischer und diverse Lexikonartikel aus der RE.