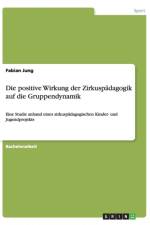von Anke Rehder
17,95 €
Studienarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich Didaktik - Englisch - Literaturgeschichte, Epochen, Note: 2,7, Christian-Albrechts-Universität Kiel, Sprache: Deutsch, Abstract: Der Empfindsame Roman The Man Of Feeling1, welcher 1771, vorerst anonym, von HenryMacKenzie (1745-1831) veröffentlich wurde, ist einer der bedeutendsten Romane seiner Zeit.Der Schottische Autor war einer der Ersten, der seine dramatis personae, aber vor allemseinen Protagonisten Harley, mit den Tugenden der Empathie und des Mitleides ausstattete.Die Epoche der Empfindsamkeit ging davon aus, dass der Mensch von Natur aus gut sei undauch nicht die Vernunft die maßgebende Qualität des Menschen sei, sondern dass gerade diebereits erwähnte Empathie und das Mitleid diese Qualitäten ausmache.2 Nach Auffassung derEmpfindsamkeit, welche vorwiegend von 1740- 1790 ihren Ausdruck hatte, hatten Gefühleeinen großen Anteil an den ethischen Entscheidungen. Das Gefühl war nicht mehr länger einMakel des Menschen, sondern zeichnete ihn als sittlichen Mitbürger aus.Auch Henry Mackenzie nimmt diesen Eindruck in seinem Roman auf, indem er denProtagonisten Harley, den ¿man of feeling¿, als sehr sensiblen, wohltätigen und verletzlichenMann darstellt. Harley wird als ein Subjekt vorgestellt, welches starkes Mitgefühl mit seinenMitmenschen hat und dadurch oft in für ihn schwierige Situationen gerät. Es ist nichtverwunderlich, dass der Roman sofort erfolgreich war, da er die Bedürfnisse der Menschen indieser Zeit aufgriff und ihnen einen Einblick in die neue Humanität ermöglichte. Dies tatMackenzie jedoch nicht, indem er den Lesern eine neue Lebens- und Denkweise präsentierte,die ein besseres Leben versprach, sondern er wollte eher einen Wandel im Denkenhervorrufen. Da der Protagonist in TMOF mit seiner Wesensart vielmehr droht in derGesellschaft zu scheitern, regt Mackenzie so das Überdenken und Abwägen, das kritischeHinterfragen und das subjektive Empfinden des Lesers an und präsentiert ihm, dem Leser,keine Patentlösung des richtigen menschlichen Verhaltens in der Gesellschaft. In der folgenden Arbeit möchte ich versuchen, das von Henry MacKenzie präsentierteMännlichkeitsbild darzustellen. Um dieses in Abgrenzung zum traditionellen Bild zuverdeutlichen, möchte ich in Punkt Zwei sowohl die herkömmliche Rolle des Mannes des 18.Jahrhunderts als auch die heutigen Rollenklischees kurz anreißen, um Parallelen und Schlüsseziehen zu können.===1 Im Verlauf der Arbeit werde ich den Titel des Romans häufig durch die Abkürzung TMOF abkürzen.2 http://www.leinstein.de/media/2432/erzaehlliteratur%201700-1830.pdf. Zugriff am 15.01.2011.