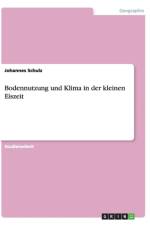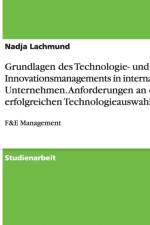von Ernst Probst
18,99 €
Fachbuch aus dem Jahr 1992 im Fachbereich Archäologie, , Sprache: Deutsch, Abstract: Wann, wo und wie lebten die ersten Vormenschen, Frühmenschen, Altmenschen und Jetztmenschen? Wie sahen sie aus, wie groß wurden sie, an welchen Krankheiten litten sie, welche Kleidung und welchen Schmuck trugen sie, wie haben sie gewohnt, was haben sie gegessen und getrunken, und was haben sie geglaubt?Auf alle diese und viele andere Fragen soll das Taschenbuch ¿Rekorde der Urmenschen¿ eine Antwort geben. Es schildert die Entwicklung von noch affenähnlichen Vormenschen bis zu vernunftbegabten Jetztmenschen jener Art, zu der auch wir gehören.Die ersten Behausungen des Menschen werden ebenso behandelt wie die frühesten Siedlungen, Befestigungsanlagen, Seeufersiedlungen, Tempel, Möbel, Kleidungs- und Schmuckstücke, Werkzeuge, Waffen, Haustiere, Musikinstrumente und Kunstwerke. Außerdem erfährt man viel über die Krankheiten und Verletzungen unserer frühen Vorfahren, die ersten Operationen und die Medizinmänner der Steinzeit.Weitere Themen sind die Tiere, die von Menschen gejagt wurden, die Anfänge der Religion mit den ersten Bestattungen, Kannibalismus und Menschenopfern, die frühesten Tauschgeschäfte, Boote, Wagen, Straßen, Reittiere, der Beginn von Ackerbau und Viehzucht sowie Töpferei, die früheste Nutzung von Metallen und die erste Schrift. Das Wissen über diese ¿Rekorde der Urmenschen¿ ist in unzähligen Büchern, Fachpublikationen, Zeitungs- und Zeitschriftenartikeln verstreut, die häufig den Laien nicht bekannt, zugänglich und manchmal auch nicht verständlich sind, daß sie in fremden Sprachen oder einer zu wissenschaftlichen Sprache abgefaßt wurden. Das Material für das vorliegende Buch wurde durch intensives Literaturstudium in Fachbibliotheken, durch Briefe und Gespräche mit Spezialisten zusammengetragen und in allen Fällen überprüft.Jeder der erwähnten ¿Rekorde der Urmenschen¿ kann durch einen neuen spektakulären Fund übertroffen werden. Denn die Erforschung der Vergangenheit von Menschen und den Erfindungen unserer Vorfahren steht nicht still. Was heute gilt, kann morgen schon überholt sein. So ist dieses Buch lediglich der Versuch einer Momentaufnahme des gegenwärtigen Wissensstandes. Die Texte des Taschenbuches ¿Rekorde der Urmenschen¿ stammen aus dem Werk ¿Rekorde der Urzeit¿ (1992) des Wiesbadener Wissenschaftsautors Ernst Probst in alter Rechtschreibung. Daraus entstanden 2008 zwei Bände: Bei ¿GRIN Verlag für akademische Texte¿ erschienen ¿Rekorde der Urzeit¿ (Landschaften, Pflanzen, Tiere) und ¿Rekorde der Urmenschen¿.