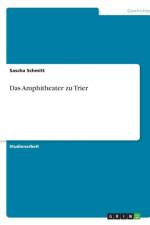von Peter (MPI f. Eisenforschung, Germany) Neumann & Düsseldorf
15,95 €
Studienarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich Geschichte Europa - and. Länder - Neuzeit, Absolutismus, Industrialisierung, Note: 2,0, Universität Leipzig, Sprache: Deutsch, Abstract: Im Palacio Episcopal in Castelo Branco befindet sich im Schlossgarten eine Treppe, die die Statuen der Könige Portugals von Afonso I. bis zu Josè I. zeigt. Sie ist noch heute begehbar und weithin ein Anziehungsmagnet für viele Touristen. Während die portugiesisch stämmigen Könige alle in einer einheitlichen Größe dargestellt sind, findet man die spanischen Habsburger, die Portugal einst 60 Jahre lang regierten, nur halb so groß vor. Ist dies ein Versehen? Oder Zufall? Wenn nicht, zeigt diese Art der Kunst dann vielleicht politische Tendenzen? Könnte es etwa Ausdruck der Verachtung gegenüber dem iberischen Nachbarn sein? Wie kam es überhaupt dazu, dass Portugal die politische Verantwortung an ein fremdes Königreich abgab?Diese Arbeit soll versuchen jene Fragen zu klären und dabei die wichtigsten Ereignisse und Personen der sechzig jährigen Herrschaft der Spanier behandeln. Dabei soll nicht nur deutschsprachige Literatur im Mittelpunkt stehen, sondern auch englische und spanische, um einen Blick für die Gesamtheit der Informationen über dieses Thema zu erhalten. Ebenso scheint es interessant zu sein, die verschiedenen Sichtweisen der betroffenen Nationen (Spanien und Portugal) zu betrachten und zu untersuchen.Einsteigend ist es nötig zu beleuchten, was die tieferliegenden Ursachen der Fremdherrschaft waren, wie es dazu kam, dass ein spanischer König die Macht übertragen bekam Portugal zu regieren. Den zweiten Teil bilden dann vor allem die Regierungszeiten der drei Habsburger, wobei natürlich die Gründe für die Bewertung zu einer guten bzw. schlechten Herrschaft kenntlich werden sollten. Dabei ist aber stets auch auf die äußeren und inneren Umstände zu achten, die zu jenen Regierungszeiten gehörten, denn sie sind oft die Ursache für politische Entscheidungen und spiegeln nicht immer die Einstellung bzw. das Wesen des Monarchen wieder.Zum Abschluss werden Gründe, Ursachen und Durchführung des Unabhängigkeitsstrebens der Portugiesen den Weg darstellen, der zur endgültigen Vertreibung der Spanier aus ihrem Land führte und die ehemalige politische Selbstständigkeit wiederherstellte.